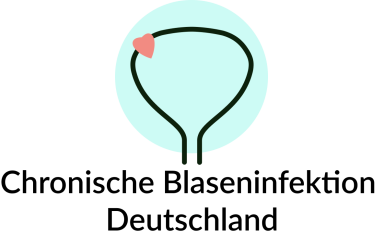| Frauenfeindliche Medizin
Der Körper als Spiegel unserer Seele
Unser Körper ist ein Wunderwerk des Lebens, ein fein aufeinander abgestimmtes System, bei dem verschiedene Mechanismen ineinander greifen. So großartig wir gemacht sind, so sensibel sind wir für äußerliche Einflüsse, die unser Gleichgewicht ins Wanken bringen können.
Das Immunsystem, die körpereigene Abwehr gegen Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten, steht in engem Zusammenhang mit der Psyche. Unsere Abwehrmechanismen im Körper umfassen mehrere Systeme, die alle von Stress beeinflusst werden. Dabei unterscheidet man zwischen dem angeborenen Immunsystem (dazu gehören z.B. bestimmte Zellen, die an der Abtötung von Bakterien beteiligt werden) und dem adaptiven Immunsystem (das gezielter wirkt und z.B. die Produktion von Antikörpern umfasst).
Während man früher davon ausging, dass Stress generell eine schwächende Wirkung auf das Immunsystem hat, zeigen neuere Erkenntnisse, dass eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig ist.
Man unterscheidet heute zwischen akutem und chronischem Stress. Beides hat gegensätzliche Auswirkungen auf die Antikörperreaktion. Während akuter Stress die Immunantwort sogar erhöhen kann, schwächt chronischer Stress das Immunsystem nachhaltig. Während akuter Stress den Transport von Immunzellen zu Infektions- und Entzündungsherden im Körper fördert, beeinträchtigt chronischer Stress diesen Mechanismus. Chronischer Stress erhöht durch die langfristigen Immunveränderungen möglicher Weise auch die Anfälligkeit für Krebs.
Unsere Nervenzellen schütten Botenstoffe aus, die man Neuropeptide nennt. Diese Neuropeptide können Immunzellen direkt beeinflussen. Negative Emotionen, wie z.B. chronischer Stress, können unser empfindliches Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen. Dies kann zu einer chronischen Entzündung führen. Das Immunsystem kann sich gegen eindringende Erreger schlechter zur Wehr setzen und Autoimmunerkrankungen (wie z.B. Neurodermitis, Schuppenflechte, Rheuma) können sich verschlimmern.
Das vegetative Nervensystem regelt wichtige Körperfunktionen, wie z.B. Atmung, Herzschlag oder Verdauung. Psychischer Stress kann zu Herz-Kreislauf-Beschwerden und Störungen im Magen-Darm-System führen. Auch längerfristiger Schlafentzug stört nachweislich die Immunprozesse.
Wenn Krankheitserreger den Körper befallen, durchdringen sie Epithelbarrieren von Schleimhaut oder Haut. Wie gut die Haut sich schützen kann, hängt in großem Maße von ihrer Dicke ab. Weil an Schleimhäuten Sekretion (Abgabe) und Absorption (Aufnahme) stattfinden müssen, darf diese nicht dick sein. Der Körper hat deshalb in Form von Proteinen andere Schutzmechanismen entwickelt. Diese Proteine werden von exokrinen Drüsen produziert, welche die Schleimhäute des Verdauungs-, Atmungs- und auch des Urogenitaltrakts auskleiden. Stress beeinflusst diese Schutzmechanismen in ihrer Funktion.
Es gibt Menschen, die Durchfall oder Herzrasen bekommen, wenn sie z.B. vor Prüfungen stehen oder Menschen, die in fremder Umgebung z.B. auf Reisen nicht mehr zur Toilette gehen können. Eine unangenehme Verstopfung kann die Folge sein.
In der klinischen Geburtshilfe können durch die Missachtung dieser Einflüsse pathologische Verläufe provoziert werden. Wenn Frauen nicht sensibel genug begleitet werden und z.B. durch grelles Licht, viele Fragen, häufige und grobe Untersuchungen etc. der Teil im Gehirn angesprochen wird, der Frauen daran hindert, angstfrei und gelöst zu gebären, können Geburtsverläufe stagnieren oder Muskulatur sich verhärten. Und obwohl diese Zusammenhänge schon lange bekannt sind, ändert sich am Umgang gebärender Frauen nichts. Dabei hat die Art und Weise, wie wir gebären und geboren werden, Einfluss auf den Rest unseres Lebens.
Wir wissen heute, dass die Wirkung von Medikamenten oder bestimmten therapeutischen Maßnahmen dadurch unterstützt wird, dass die Patienten von der Wirksamkeit überzeugt sind. Zweifeln Menschen an der Wirksamkeit eines Medikamentes, kann die Behandlung schlechter helfen. Auf diese Weise ist es auch möglich, dass Scheinmedikamente eine Wirkung zeigen. Diesen Effekt nennt man Placebo. Psychischer Stress beeinträchtigt z.B. auch die Fähigkeit des Immunsystems, Antikörper als Reaktion auf einen Impfstoff zu produzieren.
Anhaltende Beschwerden wie chronische Schmerzen, Verdauungsstörungen oder auch Herzrhythmusstörungen sind belastende Symptome für Betroffene. Noch belastender kann es sein, wenn Tests und diagnostische Untersuchungen keine klare Ursache finden. Von ärztlicher Seite wird dann schnell der Verdacht geäußert, dass eine somatoforme Störung besteht. Dieser Begriff bezeichnet eine Erkrankung, bei der man keine organische Krankheit feststellt oder bei der eine organische Krankheit allein nicht die Symptome erklärt. Man nimmt dann eine seelische Ursache an. Es gibt keine Untersuchung, die eine psychosomatische Ursache einer Erkrankung zweifelsfrei feststellen kann. Das macht es schwierig, eine eindeutige Diagnose zu stellen. Es bedarf fachkundiger Ärzte, einer umfassenden Diagnostik und interdisziplinärer Zusammenarbeit, um Menschen mit Symptomen unklarer Ursache gut beraten und begleiten zu können.
Die enge Verbindung
Körper und Psyche stehen in enger Beziehung zueinander und üben gegenseitigen Einfluss aus. Die Wahrheit ist, dass eine Krankheit nie rein körperlich oder rein psychisch ist. Es gibt nur eine Mischung aus beiden. Die Gewichtung beider Einflüsse kann allerdings sehr stark variieren.
Chronische körperliche Leiden können z.B. Depressionen auslösen. So berichten viele Patienten mit eingebetteten Blaseninfektionen, dass die fehlende Behandlung und die daraus resultierenden Schmerzen bei ihnen zu verschiedenen psychischen Erkrankungen geführt haben. So erzählt eine Frau, dass ihre unbehandelte, eingebettete Blaseninfektion zu einer folgenschweren posttraumatischen Belastungsstörung geführt hat.
Emotionale Konflikte spielen sich zumeist eher subtil und unterbewusst ab. Wir verdrängen sie häufig, weil die Auseinandersetzung damit schmerzhaft und belastend sein kann. Und auch wenn Verdrängung im Alltag ein guter Weg sein kann, den Schwierigkeiten des Lebens zu begegnen, kann diese Verdrängung auch krank machen. Körperliche Symptome dienen der Seele dann als Mittel, um traumatische oder verletzende Geschehnisse nicht ins Bewusstsein kommen zu lassen.
Stigmatisierung
Psychisch bedingte Beschwerden sind keine eingebildeten Beschwerden oder „gar nicht schlimm“. Sie verleiten Mediziner dazu, Patienten weniger ernst zu nehmen und führen immer wieder dazu, dass Menschen mit Beschwerden, deren Ursache Mediziner nicht klären können, stigmatisiert und allein gelassen werden. Und in manchen Fällen entstehen durch die Nichtbehandlung sehr gefährliche Situationen.
Seltene Erkrankungen
Die Autorin und Kulturhistorikerin Elinor Cleghorn litt mit 20 Jahren unter schmerzenden Beinen und konnte kaum noch laufen. Sie konsultierte einen Arzt, der sich die Symptome nicht erklären konnte und diese am Ende auf “ihre Hormone” zurückführte. Sie hatte viele Termine bei Fachärzten und auch in der Alternativmedizin, aber niemand fand eine Erklärung. Sie begegnete Ärzten, die ihre Probleme überheblich herunterspielten, sie belächelten und wie ein kleines und wehleidiges Kind behandelten. Irgendwann wurde Frau Cleghorn schwanger und ihre betreuende Frauenärztin stellte fest, dass das Herz ihres ungeborenen Kindes zu langsam schlägt. Die Frauenärztin ließ ihr Blut untersuchen und fand darin Antikörper, die das Herz ihres Kindes bereits geschädigt hatten. Weil sofort eine Behandlung erfolgte, konnte das Leben ihres Kindes gerettet werden. Aber nachdem das Kind geboren war, interessierte niemanden mehr das Auftreten des schädigenden Antikörpers. Der Antikörper aber verschwand nicht und konnte so weiter in ihrem Körper großen Schaden anrichten. Ihr eigenes Herz wurde so geschwächt, dass Elinor Cleghorn zusammenbrach. Nun erst wollten Ärzte genauer hinschauen und man fand heraus, dass sie unter Lupus erythematodes, einer unheilbaren Autoimmunerkrankung, leidet. Viele Jahre mit starken Schmerzen und fast lebensbedrohlichen Ausgang lagen da schon hinter ihr, weil kein Arzt Frau Cleghorns Symptome ernst nahm. Zehn Jahre später schrieb Elinor Cleghorn ein Buch. In Deutschland erscheint es unter dem Titel “Die kranke Frau”. Es ist ein wichtiges Buch, das sehr deutlich macht, wie frauenfeindlich unsere Medizin noch heute ist.
Dass es immer wieder seltene Erkrankungen gibt, über die viele Ärzte nichts wissen, zeigen eindrucksvoll Sendungen wie „Abenteuer Diagnose“ des NDR. In der Sendung werden Menschen vorgestellt, die unter verschiedenen Symptomen litten, deren Ursache zunächst nicht geklärt werden konnte. Oft haben diese Menschen lange und schmerzhafte Leidensgeschichten hinter sich, bis die richtige Diagnose gestellt wurde. Eine Patientin mit einer sehr seltenen genetisch bedingten Darmerkrankung landete auf einer psychiatrischen Station für Magersüchtige, weil sie sehr schnell sehr viel Gewicht verloren hatte und man ihr unterstellte, magersüchtig zu sein. Ein Mann, der starke Durchfälle hatte, wurde vermittelt, die Symptome seien psychisch bedingt, obwohl am Ende eine durch ein Tier übertragene parasitäre Erkrankung dahinterstand. Ein „einfacher“ Vitaminmangel führte bei einer Sportlerin zu Symptomen eines Herzinfarktes oder krampfartige Bauchschmerzen stellen sich irgendwann als Gallensteine und rätselhafte und lang andauernde Symptome als unerkannte Borreliose heraus.
Wie kann es sein, dass eine Wissenschaft, wie die Medizin, den weiblichen Körper mit all seinen Symptomen und Krankheiten bis heute so fahrlässig vernachlässigt?
Frauen warten in der Regel länger auf Diagnosen, erhalten mehr Fehldiagnosen, leiden statistisch gesehen häufiger an chronischen Krankheiten und werden öfter falsch mit Medikamenten behandelt.
Weil in Deutschland die Medizin – im Gegensatz zu anderen Ländern – über eingebettete Blaseninfektionen wenig Wissen hat, verpacken Mediziner ihre eigene Unwissenheit und Unsicherheit und überreichen sie den betroffenen Patienten ausschließlich als psychosomatische Erkrankung. Ohne Frage unterliegt der physische Körper psychischen Einflüssen. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Aber es ist ein Skandal, dass Symptome, die sich Mediziner nicht erklären können, automatisch als ausschließlich „psychosomatisch“ abgetan werden, obwohl es dafür sehr wohl (auch) physische Ursachen geben kann.
Seit dem Einsatz kurzer oder sogar einmaliger Antibiotikagaben hat sich die Anzahl an Frauen mit Symptomen einer eingebetteten Blaseninfektion rasant erhöht. 2021 veröffentlichte der bereits verstorbene Professor Dr. James Malone-Lee ein beeindruckendes Buch über das Krankheitsbild. In seinem Buch “Cystitis unmasked“ beschreibt er ausführlich die Erkrankung und die Forschung zu diesem Thema. Er konnte nachweisen, dass sich die Zahl der Menschen mit chronisch eingebetteten Blaseninfektionen signifikant erhöht hat, seit die offiziellen Leitlinien nur noch eine Therapie von höchstens drei Tagen bei unkomplizierten Harnwegsinfekten empfiehlt.
„Das tut halt einfach ein wenig weh und geht irgendwann vorbei“, bekommen viele Frauen dann zu hören...
Mangelndes Wissen
Das fehlende Wissen über diese Erkrankung hat dazu geführt, dass Frauen nur mangelhaft behandelt wurden und sich folgenschwere Erkrankungen entwickeln konnten. Was in Großbritannien schon länger eine anerkannte Erkrankung ist, die Aufmerksamkeit in offiziellen Leitlinien erfahren hat und vom öffentlichen Gesundheitssystem in speziellen Fachkliniken erfolgreich behandelt werden kann, ist bei uns „psychisch bedingt – ohne organische Ursache“.
Viele Frauen werden in Deutschland außerdem fälschlicherweise mit IC (Interstitieller Cystitis) diagnostiziert. Die Behandlung einer IC erfolgt in der Regel lebenslang durch Opioide und einer älteren Version eines Psychopharmaka, das als Nebeneffekt auf die Blase einwirkt und zusätzlich bei den meisten Personen zu einer starken Gewichtszunahme führen kann. Aber auch eine dauerhafte Einnahme von Psychopharmaka kann die Darmflora schädigen. Während Antibiotika die Ursache beheben können (und dadurch irgendwann die Einnahme beendet ist), lindert die Behandlung bei IC im besten Falle die Symptome, während die Ursache sich chronifizieren und verschlimmern kann.
Wenn Frauen über Symptome einer Harnwegsinfektion klagen und man durch Urinsticks oder angelegte Kulturen keine Erreger ausfindig machen kann, werden sie ohne eine Behandlung weggeschickt. Dabei sind Urinsticks und Kulturen sehr unzuverlässige Testmethoden.
Und eine Frau, die immer wieder über Symptome einer Harnwegsinfektion klagt, wird irgendwann eine unbeliebte Patientin. Schnell kommt der Vorwurf, zu empfindlich zu sein, zu sehr zu jammern und überhaupt sich einfach zu sehr anzustellen.
Betroffene Frauen werden ignoriert oder mit skurrilen Mythen und Vorwürfen konfrontiert: “Immer von vorn nach hinten wischen” und “kein vaginaler Sex nach analem Sex” oder “was stimmt mit ihrer Partnerschaft nicht?”, “sie sind nur verkrampft", "sie dürfen nur weiße Wäsche tragen” und “die Kultur zeigt keine Erreger, deshalb bilden sie sich das nur ein” …
Misogynie in der Medizin
Unsere weltweite sexistische Medizin macht Frauen krank.
Bis zu 80% aller Krankheiten und Medikamente werden nur an Männern untersucht. Ob Tabletten oder Therapien – in den meisten Fällen basieren die dazugehörenden Studien auf Testungen an Männern. Studien an Männern waren und sind einfacher umzusetzen. Das Verhältnis sollte sich aber idealerweise an der tatsächlichen Geschlechterverteilung der Krankheit orientieren.
Bis in die 90er Jahre wurden fast ausschließlich Männer für Studien genutzt und daraus medizinische Empfehlungen abgeleitet. Frauen bekamen dieselbe Dosis wie Männer und dies hatte im schlimmsten Fall tödliche Auswirkungen. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Zeit, in der der Körper die Wirkstoffe eines Medikamentes abbauen kann. Die Hormone Östrogen und Progesteron bestimmen, wie viele Enzyme in der Leber ganz bestimmte Wirkstoffe abbauen. Je mehr dieser Hormone vorhanden sind, desto verlangsamter ist der Abbau. So ist es nicht verwunderlich, dass bei Frauen verschiedene Medikamente unterschiedlich wirken. Hormonelle Schwankungen bei Frauen müssten mehr berücksichtigt werden.
Auch wenn heute nahezu alle Studien mit Männern und Frauen durchgeführt werden, ist das Verhältnis trotzdem nicht ausgewogen und EU-Verordnungen legen zudem nicht fest, dass die geschlechtsspezifischen Dosierungen getrennt ausgewertet werden müssen.
Auch Studienleiter waren in der Vergangenheit in der Regel Männer. Noch immer sind die leitenden Köpfe vieler Institute Männer und die Studien von männlichen Forschern werden häufiger in Publikationen zitiert. Männer sind in der medizinischen Ausbildung der Standard, teilweise fehlen noch immer in weiblichen anatomischen Abbildungen korrekte Details. In medizinischen Lehrbüchern ist der männliche Körper der Prototyp eines menschlichen Organismus.
Der weibliche Körper
2021 kritisierte die Soziologin Christina Mundlos öffentlich eine Broschüre der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“, in der z.B. befremdliche Mythen z.B. über das Jungfernhäutchen verbreitet wurden. Das Jungfernhäutchen soll „möglichst heil bleiben“ und „kann beim ersten Sex bluten“. Dass es ein Jungfernhäutchen gar nicht gibt und man eher über einen vaginalen Kranz sprechen sollte (den auch nicht jede Frau hat), schienen die Autoren offensichtlich nicht zu wissen oder bewusst ignoriert zu haben. In der Broschüre „Kleines Körper-ABC“, die millionenfach an Schulen in ganz Deutschland ausgeteilt und verbreitet wurde, befanden sich nachweislich falsche Informationen, wie z.B. die Behauptung, dass die Klitoris „klein wie eine Perle“ (Seite 46) sei. Die Klitoris ist aber bereits ohne Schwellung zehn bis 13 Zentimeter groß und damit größer als ein Penis und liegt tief im Körper. Nach entsprechenden Protesten und einer sehr erfolgreichen Petition musste die frauenfeindliche Broschüre überarbeitet werden. So unterstützte die BzgA die Einschüchterung von Frauen durch ihre falschen Informationen.
Christina Mundlos schrieb auch das Buch "Gewalt in der Geburtshilfe", in dem sie auf schockierende Missstände aufmerksam macht, denen schwangere und gebärende Frauen ausgeliefert sind. In diesem Buch wird deutlich, wie fest verankert das frauenfeindliche Denken auch in der Geburtshilfe ist und wie sehr unsere Gesellschaft den Umgang damit als "normal" verankert hat. Der tief verwurzelte Sexismus und die patriarchalen Strukturen verhindern bis heute eine vorurteilsfreie und geschlechtergerechte Versorgung von Frauen. Eine Frau, die die medizinische Routine in Frage stellt und kritisiert, ist eine unbequeme Frau.
In der DDR wurden Mädchen und Frauen, die von der Norm abweichen, schnell verdächtigt, Geschlechtskrankheiten zu haben. Sie wurden in geschlossene venerologische Einrichtungen eingewiesen. Die jüngsten Mädchen waren 12 Jahre alt. Die Forschung dazu hat gezeigt, dass die meisten Einweisungen folgten aufgrund des Vorwurfs des Herumtreibens. Die meisten Frauen waren völlig gesund. Unter dem Vorwand der Gesundheitsfürsorge erfuhren die Frauen und Mädchen Demütigung und Gewalt. Sie wurden täglich gegen ihren Willen gynäkologisch untersucht und misshandelt. Auf einigen Stationen mussten die Frauen tägliche Putzarbeiten verrichten oder wurden für Kosmetik- und Medikamententests missbraucht.
Eine von Männern dominierte Medizin sorgt sich in erster Linie um den männlichen Körper. Diese Medizin interessiert sich nicht für Krankheiten, die in der Regel Frauen betreffen: Endometriose, Autoimmunkrankheiten oder das HELLP-Syndrom.
Weil Frauen bis in das 19. Jahrhundert einzig dazu bestimmt waren, Kinder zu gebären und den Nachwuchs großzuziehen, konzentrierte sich die Medizin in erster Linie auf ihre Fortpflanzungsorgane. Es gab Ärzte, die davor warnten, dass Frauen Zugang zu Bildung erhielten, weil diese sonst nicht ihren eigentlichen Bestimmungen (zu gebären und Kinder großzuziehen) nachgehen könnten. Frauen, die sich dieser Aufgabe nicht fügten, wurden oft körperlicher Gewalt ausgesetzt. Die Therapie sah dann z.B. Klitorisbeschneidungen, Entfernungen von Eierstöcken oder Gebärmutter oder sogar Lobotomie vor.
Dass Frauen immer wieder Therapien ausgesetzt waren, die man heute als Körperverletzung bezeichnen würde, wird an vielen Beispielen deutlich. Sigmund Freud empfahl Prinzessin Alice, der Mutter von Prinz Philip, eine damals übliche Behandlungsmethode. Er führte ihre angeblichen Wahnvorstellungen auf sexuelle Frustration zurück und riet dazu, ihre Libido zu senken. Ihre Eierstöcke setzte er einer intensiven Röntgenstrahlung aus, um die aufsässige und unbequeme Frau vorzeitig in die Wechseljahre zu versetzen.
Auch im 20. Jahrhundert gibt es nicht genug wissenschaftliche Forschung zur Frauengesundheit. In den 50er Jahren werden Frauen im großen Stil Beruhigungsmittel und Psychopharmaka verschrieben. Besonders oft kommt es zu Verschreibungen dieser Mittel, wenn die Symptome der Frauen nicht erklärbar sind und man keine Ursache findet. Aber nur weil man keine Ursache findet, bedeutet dies nicht, dass es keine gibt.
Auch wenn es in der Geschichte der Medizin viele männlich dominante Stimmen gab, die dazu beigetragen haben, dass sich patriarchale Strukturen verfestigen konnten, gab es auch Gegenstimmen, die mutig und laut wurden und dagegen aufbegehrt haben. Oft waren es die Frauen. Ihnen lag wenig daran, nachzuplappern. Sie waren neugierig und verstanden es, genauer hinzuschauen und selbstständig zu denken. Und wir brauchen heute Menschen, die den Mut haben, unbequeme Fragen zu stellen und neue Wege zu gehen.
Quellen:
- "Wie unsere Psyche die Gesundheit beeinflusst", BR Fernsehen, Dr. Klaus Tiedemann
- "Abenteuer Diagnose: Wie Ärzte und Patienten mysteriösen Krankheiten auf die Schliche kommen. Wahre Medizingeschichten", Heyne Verlag
- "Warum Frauen medizinisch benachteiligt sind", Bericht von Quarks & Co
- "Der Körper als Spiegel der Seele – Psychosomatische Erkrankungen erkennen", Bundeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V., Dr. Beatrice Wagner
- "Cystitis unmasked", Prof Dr James Malone-Lee
- "Die Wirkung von Stress auf die Abwehrsysteme", D. Dragos, MD Tanasescu, National Library of Medicine, Journal of Medicine and Life
- "Die kranke Frau", Elinor Cleghorn
- "Psychopharmaka auf Abwegen", Anette Mende, Pharmazeutische Zeitung
- "Gewalt in der Geburtshilfe", Christina Mundlos
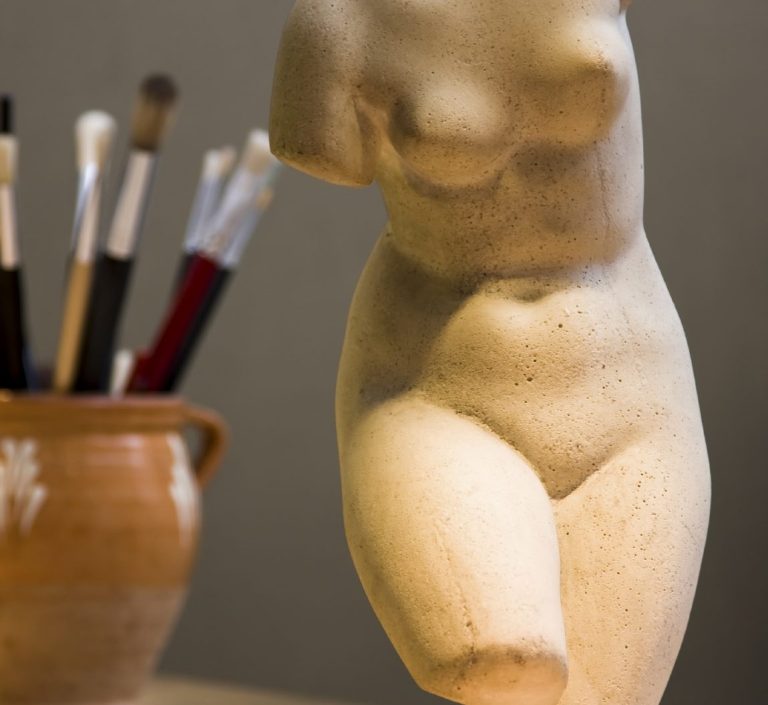
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.